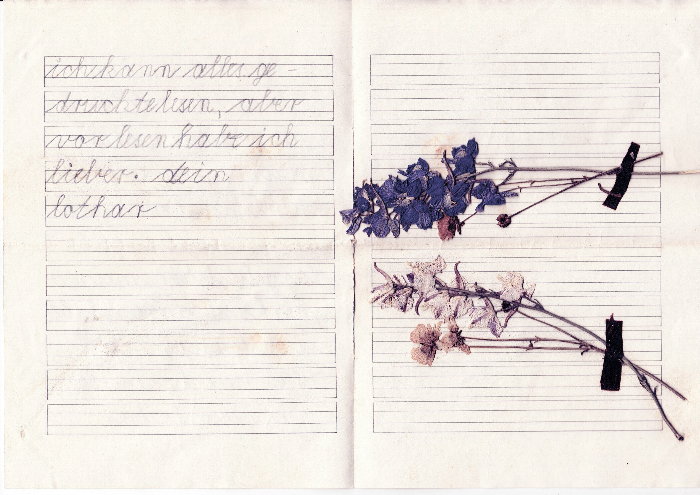Oberammergau, 8.5.1960, an Ch. Rumold: „Christl, mein Schatz! […] Wenn ich samstags arbeite, ist mir im allgemeinen nicht recht wohl. [Offenbar fühlte er sich noch immer an die Regel der Adventisten gebunden, L. R.] Zum Glück hatte ich gestern einen guten Arbeitsgeist und dein Brief ließ mich auch am Nachmittag froh bleiben und mein Zeil erreichen. Morgen werde ich mit meinem Schnitzschullehrer nach Landshut fahren und ein Wandrelief einsetzen. Ich möchte mich damit ein bissel erkenntlich zeigen für die Zeit und Mühe, die er doch immer wieder für mich erübrigt hat. Mein Zeichenlehrer hat mich auch wieder geangelt. Ach, wenn ich doch einmal ein paar tausend Mark gewinnen würde, damit ich ein ganzes Jahr nur bei diesen Männern sein könnte. Es ist nicht schön, so hin und her gerissen zu werden zwischen absolutem Kunststudium und Souvenirschnitzereien. Das Schnitzen macht mir Freude, aber der Versuch zu einem Kunstwerk verlangt für sich so viel an Schubkraft und Empfindsamkeit, das glaubt man kaum. Es ist, als wenn ein Reiter von seinem täglichen Arbeitspferd ein Turnierpferd besteigt. In München in der Gauguin-Ausstellung war ich noch nicht. Mein Zeichenlehrer hat mir sogar davon abgeraten. Ich habe allerdings auch in verschiedenen Kunstbüchern eine negative Kritik über G. gelesen. Er war wie Utrillo ein genialer Individualist und hat unserem Jahrhundert eitwas von sich gesagt, aber er konnte nicht die bisherigen Sprachen zusammenfassen und um einen weiteren Baustein bereichern. Picasso brachte das fertig, deshalb ist er das Genie der Kunst in unserer Zeit. Das habe ich allerdings nicht gelesen. Die Übung in der Arbeit zeigt einem das von alleine. – […] In der kommenden Woche beginnt ja das große Rennen. Ich fürchte ein Fiasko. Wir haben jetzt einen supermodernen großen Geschäftsraum gebaut, aber keinen Vorrat an Schnitzereien. Die Arbeiter tun nicht mehr viel, wenn sie im Theater spielen und der Chef kniet wohl auf mir herum, aber ich kann ja nicht mehr als das Zeugs sausen lassen so viel ich zusammen kriege. Es bleibt immer nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. (Ein Glück, daß die Firma mich hat.) Aber ich wollte noch ein bissel auf deinen Brief eingehen. Ich sehe immer wieder meine beiden Kinder auf ihrem gemeinsamen Stuhl sitzen. Ach, wir sind doch glücklich, wenn wir zufrieden sind, und wenn der Kaffeekampf einen ganzen Sonntagmorgen dauern darf, ist ’s grad schön. Wie bald sind wir alle vier älter und da setzt sich jeder der beiden Spatzen viel zu früh in seinen eigenen Sessel. Christl, dein Erzählen über Lothars ausgesprochene Freude, weil du seinen Wunsch nicht vergessen hast, hat mich auch mit einem überraschten Erstaunen schmunzeln lassen. Aber ich bin sehr froh, wenn ich bei Lothar bin und wir, du und ich, ihm zwei sorgende Eltern sein können. Lothar beobachtet scharf, er sieht bald, was ein lebendiger Mensch zum Leben braucht. Ich glaube ich muß noch viel an mir erziehen, um einmal sein Herz zu gewinnen. Aber ich bin glücklich um solch einen Menschen. Nach deinem Brief habe ich mir gedacht: Unsere Barbara holt sich ganz einfach soviel Liebe wie sie braucht und wer könnte ihr widerstehen und Lothar wartet auf sie. […] Gestern Nachmittag hörte ich dem Radio zu. Zwischen angenehmen Melodien kamen immer so erzählte Lebensbeobachtungen. Übrigens fiel mir auf, daß sich die meisten Erzähler über sich selbst lustig machten. Es scheint große Mode zu sein, den Wilhelm Busch nachzuahmen. An der ersten Glossierung hatte ich noch Spaß. Ein ‚ahnungsloser‘ Ehemann freute sich auf die Urlaubsreise mit seiner Frau nach Spanien und träumte schon vom warmen Land, kühlem Wein, bis ihm seine Frau so nebenbei sagte: Spanien ist das Land, in dem du einmal Kavaliere sehen und studieren kannst. Nun, sie kamen in jenes Land und die Männer benahmen sich halt – normal. Bei jedem unangenehmen Zusammentreffen konnte der Ehemann jetzt fragen: ‚Sind das die Kavaliere?‘ – Am Ende der Geschichte gestand der Erzähler verschmitzt: ‚Ich hatte halt Glück.‘ – Ja, mir gefallen solche Kohlesäureperlen im Weinglas des Zusammenlebens zweier Menschen.“